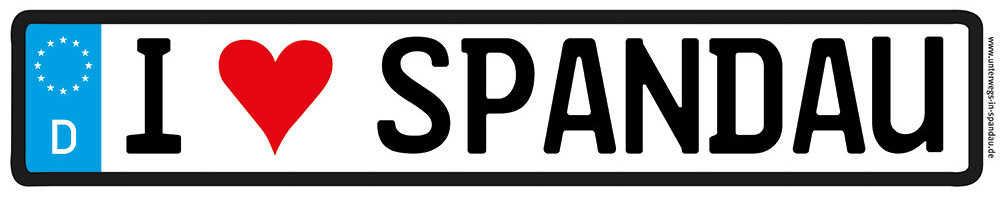Spandauer Kindheits-Erinnerungen von Jörg Sonnabend 1945-49
Teil 5

Dank Nachtwächter Otto wurde es warm
Eins der großen Probleme in den ersten Nachkriegswintern und es waren strenge Winter, war das Heizmaterial. Unsere Wohnung war eine Werkwohnung der Lanke-Werft, meine Mutter arbeitete dort als Buchhalterin. Von einem Werftbetrieb konnte allerdings in der ersten Nachkriegszeit keine Rede sein, man hielt sich mit Reparaturen und Autoaufbauten (hier besonders für die Engländer) über Wasser.
Die Beschaffung von Heizmaterial war vorerst für uns kein Problem. Grund dafür war der Nachtwächter Otto, mit dem meine Mutter etwas befreundet war. Auf der Rückseite unseres Wohnhauses befand sich der Kohlenbunker der Werft, noch aus Kriegszeiten her wohl gefüllt mit Briketts.
Otto ließ ab und zu mal den Schlüssel zum Kohlenbunker stecken und gab uns ein Zeichen. In etlichen Nacht und Nebel Aktionen habe ich so manchen Zentner Kohlen „sicher gestellt“ um unserem Ofen wenigstens ein bisschen Wärme zu entlocken. Aber die Briketts waren auch ein hervorragendes Tauschmittel, um z.B. an Schuhe oder an andere dringend benötigte Dinge des täglichen Bedarfs zu kommen. Die Beschaffung von Brennholz war für mich kein Problem, wir wohnten ja im Grünen und waren von Bäumen umgeben, da musste so mancher Baum seinen Weg durch den Ofen gehen. Man durfte sich nur nicht dabei erwischen lassen.
Biogas ist ein alter Hut
Außerdem hatte die Lanke-Werft einen alten Büssing-LKW, der wie damals üblich mit Holzgas betrieben wurde. Zum Verständnis: Der Holzgasantrieb, der heute noch von Energiesparern unter den Namen Biogas propagiert wird, wurde in den Mangeljahren des Krieges als Antriebsenergie entwickelt.
Die Autos hatten einen zylinderförmigen eisernen Ofen bei sich (ca. 1 m Durchmesser) in den durch Schwelbrand der Holzstückchen ein brennbares Gas zum Antrieb entwickelt wurde. Dieser LKW brauchte also zum Antrieb jeden Tag mehrere Säcke kleiner Holzstückchen. Diese Holzstückchen, die sich natürlich auch als „normales“ Brennmaterial eigneten, wurden auf der Werft, in der Bootsbauhalle an der Säge zugeschnitten. Auch hier ließ Nachtwächter Otto öfter mal den Schlüssel stecken und wir konnten unsere Brennholzvorräte ergänzen.
Kindervergnügen auf dem Kriegspfad und Nahrung
Wir Jungs empfanden diese Zeit, die eigentlich schwer und entbehrungsreich war, immer etwas abenteuerlich. Hatten wir im Kriege „Soldaten“ gespielt, so war jetzt das „Indianer spielen!“ angesagt. Karl-May-Romane, die jetzt unser bevorzugter Lesestoff waren, wurden nachgespielt. Unsere „Bewaffnung“ waren Katapulte oder unsere „Katschis“ wie wir sie nannten.
Der Fachausdruck heute ist „Steinschleuder“. An einer Astgabel, meistens von einem Fliederstrauch, wurden zwei Streifen Gummi befestigt, hinten kam ein Stückchen Leder zur Aufnahme des Steins ran und fertig war das „Katschi“. Die Gummistreifen, herausgeschnitten aus einem alten Autoschlauch, verliehen dem Kieselstein oder auch manchmal einer selbst gegossenen Bleikugel Geschwindigkeit und Durchschlagskraft, so dass diese Katapulte schon eine wirksame Waffe waren.
Wir hatten mit diesen Katapulten eine große Fertigkeit entwickelt, viele Klingelknöpfe, Hausnummernschilder oder auch Glühbirnen mussten „dran glauben“. Auch wurden sie als Waffe bei unseren Cliquenkämpfen eingesetzt, ernstliches ist Gott sei Dank nicht passiert aber blaue Flecke gab es schon mal. Bei aller kindlichen Phantasie und Abenteuerlust die wir an den Tag legten war eine Sache bei uns immer vorrangig und die hieß: Beschaffung von etwas Essbarem. Wir kannten die „Zugänge“ sämtlicher in der Nähe liegenden Obstplantagen und Gärten unsere Zusatznahrung hieß Obst, wenn es auch manchmal nicht ganz reif war.
Eine andere „Nahrungsquelle“ waren die in unserer Nähe liegenden Rieselfelder (zwischen Gatow und Wilhelmstadt). Ein Teil dieser Rieselfelder hatte man umgepflügt und mit Gemüse bepflanzt. Auf diesen überdüngten Boden gediehen die Pflanzen natürlich prächtig, es waren hauptsächlich Mohrrüben, Kohlrabi und Kohl. Da die Felder mit Hunden bewacht wurden, war es nicht einfach an diese Schätze heran zu kommen.
Aber wir hatten nicht umsonst unsere Karl-May-Bücher gelesen, wir wussten wie man sich ohne entdeckt zu werden dort „anschleichen“ konnte. Das erbeutete Gemüse haben zu Hause abgeliefert oder auch in unseren „Höhlen“, die wir immer an versteckten Plätzen gebaut hatten, roh gegessen.
Karges Essen und seine nicht immer einfache Zubereitung
Eine andere Quelle, um den mageren Speisezettel etwas zu beleben, war das Angeln in der Havel. Einen Angelschein, den man auch damals nach dem Kriege schon brauchte hatten wir natürlich nicht. Auch war es schwer sich Angelzeug zu besorgen. Da es nichts zu kaufen gab musste man improvisieren. Am schwersten war es Angelhaken und Angelsehne zu bekommen. Hier blieb meistens nur der Tauschweg.
Als Angelruten eigneten sich hervorragend lange Haseläste. Angelposen stellten wir uns selbst her, aus Federkielen und Korken. Gefangen wurden meistens Plötzen, Rotfedern und Güstern, wenn man Glück hatte, war auch mal ein Aal dabei. Meine Mutter hat jedenfalls immer alles verarbeiten können. Ganz gefahrlos war das natürlich nicht, manchmal wurden wir schon von der Wasserpolizei gejagt und sind dabei auch schon mal die Angeln losgeworden.
Um zu verdeutlichen warum wir solche abenteuerlichen Spielchen machten um an zusätzliche Nahrungsmittel zu gelangen, schildere ich mal kurz wie die Verpflegung eines normalen Tages aussah: Morgens zwei Scheiben Brot mit etwas Margarine (selten Butter) und Marmelade oder Sirup. Zum Trinken gab es Muckefuck (Kaffeeersatz) gesüßt mit Süßstofftabletten. Unser Schulbrot bestand auch aus zwei Scheiben Brot, die mit Margarine oder dünn mit Butter beschmiert waren, manchmal gesellte sich eine Scheibe Wurst dazu.
Da wir in der Schule noch unsere Schulspeisung erwarteten wurde meistens das Pausenbrot schon auf dem Schulweg aufgegessen. Als Mittagessen gab es überwiegend Eintöpfe, bestehend aus irgendein Gemüse, zusammen gekocht mit Kartoffeln. Manchmal waren es auch nur Pellkartoffeln mit einer „Mehlstippe“. Heute würde man sagen: eine fettarme Kost.
Besonders gut schmeckten mir die Pellkartoffeln wenn ich sie in Zuckerrübensirup einstippen konnte. Zum Abend gab es meistens eine Suppe aus Roggenschrot oder Roggenmehl gekocht mit Wasser und mit Süßstoff gesüßt. Zwei oder drei Scheiben Brot, die auf der Herdplatte geröstet wurden (heute sagen wir getoastet) aßen wir dazu. Mit dem o.g. Zuckerrübensirup hatte es eine besondere Bewandtnis: er wurde nämlich aus Zuckerrüben selbst hergestellt.
Bei uns in der Nähe, zwischen Gatower Straße und Potsdamer Chaussee, am Ende der Rieselfelder, lag das „Stadtgut Karolinenhöhe“. Dort gelang es uns, durch Beziehungen (Beziehungen musste man damals haben) ab und zu einen Zentner Zuckerrüben zu bekommen. Der Haken dabei war, dass man die Rüben nicht einfach so aufladen und abholen konnte, nein man musste sie selber ausbuddeln.
Nur wer etwas von Landwirtschaft versteht kann sich vorstellen wie schwer diese Arbeit ist. Die Zuckerrüben die sehr fest im feuchten Ackerboden stecken, müssen freigelegt werden und dann vorsichtig herausgezogen werden. Die lange Spitze der Rübe darf dabei nicht beschädigt, da dort der meiste Zucker sitzt. Heute gibt es bestimmt Maschinen dafür, aber damals war es eine schwere und schmutzige Arbeit. Die so „geernteten“ Rüben wurden mit einem sog. „Hamsterwagen“ nach Hause gefahren um sie dort zu verarbeiten.
Ein Wort noch zu diesen Hamsterwagen: das waren kleine zweirädrige Holzwagen, mit Alu-Rädern. Die Deichsel war abnehmbar, um den Wagen in der Bahn mitzunehmen. Um die Zuckerrüben zu Sirup zu verarbeiten lag eine dreitägige mühselige Arbeit vor uns. Die Rüben wurden im Wasser gewaschen und mit einer Wurzelbürste gründlich gereinigt. Dann wurden die Zuckerrüben geschnitzelt und in eine Waschkessel gekocht. Um an den begehrten Zuckersaft zu kommen mussten die gekochten Schnitzel jetzt ausgepresst werden. Dazu wurde eine selbst gebaute Presse benutzt, die irgend jemand besorgt hatte und die bei Bedarf im Hause immer weiter gereicht wurde.
Der so gewonnene Zuckersaft musste nun mehrere Stunden, unter ständigem Rühren, am Kochen gehalten werden, d.h. das Wasser musste verdampfen damit der begehrte Sirup übrig blieb. Aus einem Zentner Zuckerrüben wurden so ca. 11 bis 12 Gläser Zuckerrübensirup gewonnen. Heute noch kaufen wir uns ab und zu ein Glas Sirup, der Geschmack bringt einem immer wieder Kindheitserinnerungen zurück.
Man hat also immer wieder Mittel und Wege gefunden um an zusätzliche Nahrung zu kommen, denn die sog. „Lebensmittelgrundkarte“ mit 1200 Kalorien täglich reichte vorne und hinten nicht. Meine Erinnerung an diese Zeit, die alles Andere immer wieder überschattet, ist: ich hatte ständig Hunger!
Jörg Sonnabend
Ende von Teil 5
Kindheitserinnerungen von Jörg Sonnabend 1945 bis 1949
- Der Krieg war zu Ende. Aber die Leiden und Entbehrungen sollten für uns erst beginnen.
Spandauer Kindheits-Erinnerungen von Jörg Sonnabend 1945-49 – Teil 1 - Ein Abenteuerlicher Schulweg in der Spandauer Nachkriegszeit
Spandauer Kindheits-Erinnerungen von Jörg Sonnabend 1945-49 – Teil 2 - Lebensmittelversorgung der Bevölkerung nach Kriegsende
Spandauer Kindheits-Erinnerungen von Jörg Sonnabend 1945-49 – Teil 3 - Schlusengeld – 1000 Reichsmark für ein Fahrrad
Spandauer Kindheits-Erinnerungen von Jörg Sonnabend 1945-49 – Teil 4 - Sicher stellen von Heizmaterial und Nahrungsbeschaffung nach Indianer-Art
Spandauer Kindheits-Erinnerungen von Jörg Sonnabend 1945-49 – Teil 5 - Schwarzmarkt und Wintervergnügen in Spandau
Spandauer Kindheits-Erinnerungen von Jörg Sonnabend 1945-49 – Teil 6 - Zwischen grenzenloser Freiheit und Schuldisziplin
Spandauer Kindheits-Erinnerungen von Jörg Sonnabend 1945-49 – Teil 7